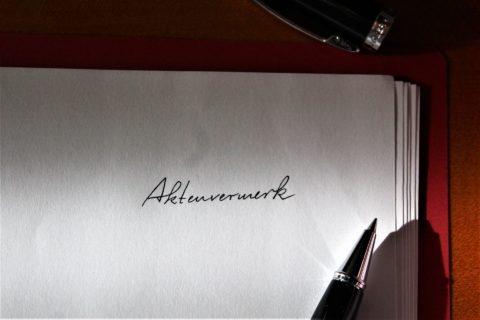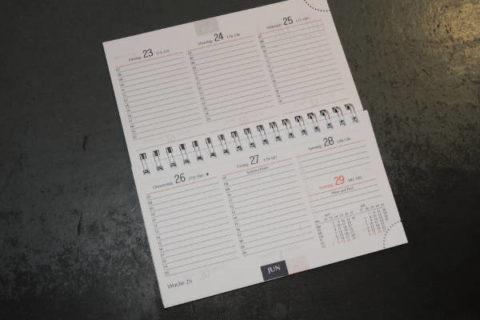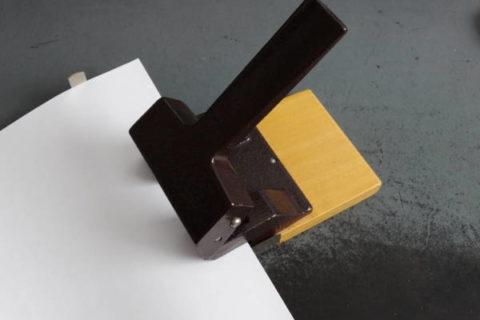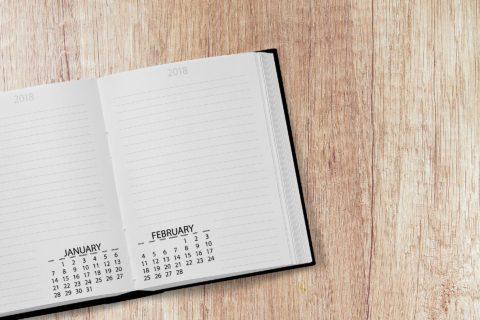Die durch §§ 127, 129 VVG, § 3 Abs. 3 BRAO gewährleistete freie Anwaltswahl steht finanziellen Anreizen eines Versicherers in Bezug auf eine Anwaltsempfehlung (hier: Schadenfreiheitssystem mit variabler Selbstbeteiligung) nicht entgegen, wenn die Entscheidung über die Auswahl des Rechtsanwalts beim Versicherungsnehmer liegt und die Grenze unzulässigen psychischen Drucks nicht überschritten wird.

Mangels Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl kann die klagende Rechtsanwaltskammer weder aus §§ 1, 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UKlaG, § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB, §§ 127 Abs. 1, 129 VVG noch aus § 8 Abs. 1, 3 Nr. 2, §§ 3, 4 Nr. 11 UWG, §§ 127, 129 VVG und §§ 1, 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UKlaG, § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB, § 3 Abs. 3 BRAO Unterlassung verlangen.
Zwar ist die Klägerin als Rechtsanwaltskammer anspruchsberechtigte Stelle i.S. des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UKlaG[1]. Ebenso folgt aus einer Abweichung von halbzwingenden Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes zum Nachteil des Versicherungsnehmers die für einen Anspruch aus § 1 UKlaG erforderliche Unwirksamkeit nach § 307 BGB[2]. Die gemäß § 129 VVG halbzwingende Norm des § 127 VVG ist aber nicht verletzt. Die angegriffenen Bestimmungen in § 5a Abs. 5 ARB 2009 verstoßen nicht gegen das Recht des Versicherungsnehmers auf freie Anwaltswahl.
Die zunächst vorzunehmende Auslegung der streitgegenständlichen Klauseln ergibt, dass die Beklagte entgegen der Ansicht der Klägerin die Liste ihrer Partneranwälte nicht offenbaren muss und folglich dem Versicherungsnehmer hieraus auch keine Auswahl zu ermöglichen braucht.
Allgemeine Versicherungsbedingungen sind nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs so auszulegen, wie ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer sie bei verständiger Würdigung, aufmerksamer Durchsicht und Berücksichtigung des erkennbaren Sinnzusammenhangs verstehen muss. Dabei kommt es auf die Verständnismöglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse und damit auch auf seine Interessen an[3].
§ 5a Abs. 5 a) bb) und b) bb) ARB 2009 knüpfen die Fiktion der Schadenfreiheit und eines nicht schadenbelasteten Verlaufs daran, dass „ein Rechtsanwalt aus dem Kreis der aktuell vom Versicherer empfohlenen Rechtsanwälte beauftragt wird“. Dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer erschließt sich aus den Bestimmungen über die Kostenerstattung in der Rechtsschutzversicherung (vgl. § 5 Abs. 1 ARB 2009) zunächst, dass der Versicherer primär keine Sachleistung erbringt, sondern lediglich Kosten erstattet. Daher weiß der durchschnittliche Versicherungsnehmer, dass er selbst den Anwalt zu beauftragen hat. Dies bestätigen ihm die streitgegenständlichen Klauseln ausdrücklich. Ihr weitergehender Regelungsgehalt erschöpft sich darin für den Fall, dass der Versicherungsnehmer einen Rechtsanwalt wählt, der aus dem Kreis der vom Versicherer empfohlenen Anwälte stammt eine Schadenfreiheit und einen nicht schadenbelasteten Verlauf zu fingieren. Auf welche Art und Weise der Versicherungsnehmer informiert wird, damit dieser einen empfohlenen Anwalt beauftragen kann, regeln die Klauseln dagegen für ihn erkennbar nicht. Sie besagen nicht, dass der Versicherer dem Versicherungsnehmer den Kreis aller Partneranwälte offenzulegen und dem Versicherungsnehmer die Auswahl hieraus zu überlassen hätte. Die von den Klauseln allein eröffnete Möglichkeit des Versicherungsnehmers zur Beeinflussung des Schadenfreiheitssystems durch Mandatierung eines empfohlenen Anwalts besteht bereits, wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer lediglich einen Rechtsanwalt nennt. Mit dieser Information kann der Versicherungsnehmer entscheiden, ob er den ihm benannten Anwalt beauftragen will oder sich stattdessen einen anderen Anwalt suchen möchte. Umgekehrt greift die Klausel auch ein, wenn der Versicherungsnehmer etwa auf Grund eines vorherigen Mandatsverhältnisses einen auf der aktuellen Empfehlungsliste des Versicherers befindlichen Rechtsanwalt mandatiert, selbst wenn in der Deckungszusage des Versicherers ein anderer Anwalt genannt worden sein sollte. Daher wird der durchschnittliche Versicherungsnehmer den angegriffenen Klauseln auch keine weitergehenden Rechte wie etwa Ansprüche auf Offenlegung aller Partneranwälte des Versicherers entnehmen.
Die Freiheit der Anwaltswahl schließt nicht jegliche Anreizsysteme des Versicherers hinsichtlich der vom Versicherungsnehmer zu treffenden Entscheidung aus, welchen Rechtsanwalt er mandatiert.
Gemäß § 127 Abs. 1 Satz 1 VVG ist der Versicherungsnehmer berechtigt, zu seiner Vertretung in Gerichts- und Verwaltungsverfahren den Rechtsanwalt, der seine Interessen wahrnehmen soll, aus dem Kreis der Rechtsanwälte, deren Vergütung der Versicherer nach dem Versicherungsvertrag trägt, frei zu wählen. Dies bedeutet kein gesetzliches Recht des Versicherers, den Rechtsanwalt auszuwählen, sondern eröffnet ihm lediglich die Möglichkeit, allgemeine Kriterien des Deckungsumfangs herauszuarbeiten. Im Rahmen des so festgelegten Leistungsumfangs steht dem Versicherungsnehmer die Auswahl des Rechtsanwalts frei[4]. Nach § 127 Abs. 1 Satz 2 VVG gilt dies auch, wenn der Versicherungsnehmer Rechtsschutz für die sonstige Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Anspruch nehmen kann.
Nach richtlinienkonformer Auslegung des § 127 VVG ist die Freiheit der Anwaltswahl nicht mit einem Verbot sämtlicher Anreizsysteme seitens des Versicherers gleichzusetzen. Liegt die Entscheidung über die Auswahl des Rechtsanwalts beim Versicherungsnehmer, ist nach der maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs eine unvollständige Deckung der Kosten zulässig, sofern die freie Anwaltswahl nicht ausgehöhlt wird, d.h. die Beschränkung der Kostenübernahme eine angemessene Wahl des Vertreters durch den Versicherungsnehmer nicht faktisch unmöglich macht. Durch somit grundsätzlich zulässige finanzielle Anreize wird die Anwaltswahl des Versicherungsnehmers erst unfrei, wenn die Verbindung zwischen Anwaltswahl und finanziellem Anreiz die Grenze des unzulässigen psychischen Drucks überschreitet.
Die in § 127 VVG inhaltsgleich übernommene[5] Vorschrift des § 158m VVG a.F. ist im Zuge der Umsetzung der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie[6] in das VVG aufgenommen worden[7]. Die Rechtsschutzversicherung gehört damit zu den wenigen Bereichen des Versicherungsvertragsrechts, die gemeinschaftsweit harmonisiert sind[8]. Nationale Umsetzungsnormen wie § 127 VVG sind bei ihrer Anwendung richtlinienkonform auszulegen[9].
Zur Vermeidung von Interessenkollisionen nach Aufhebung der bis zum Inkrafttreten der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie in Deutschland üblichen Spartentrennung muss neben organisatorischen Vorgaben (vgl. hierzu Art. 3 der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie) nach Art. 4 der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie die freie Anwaltswahl in jedem Rechtsschutzversicherungsvertrag für die Vertretung in Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie bei der Entstehung konkreter Interessenkollisionen vorgesehen sein. § 158m VVG a.F. diente der Umsetzung dieser Vorgaben. Wegen der in Deutschland – anders als in anderen EUStaaten – nicht möglichen Eigenwahrnehmung der Interessen des Versicherungsnehmers durch den Versicherer wurde dabei festgelegt, dass dem Versicherungsnehmer das Recht auf freie Anwaltswahl nicht nur bei Gerichts- und Verwaltungsverfahren zusteht, sondern auch im Bereich der außergerichtlichen Wahrnehmung[10].
Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich, dass § 158m VVG a.F. allein der Richtlinienumsetzung dienen sollte. Es sollten über das EGrechtlich seinerzeit Gebotene hinaus nur einige, in diesem Zusammenhang nicht interessierende Korrekturen der damaligen Gesetzeslage vorgenommen werden[11]. Die Gesetzesbegründung betont, das Recht der Rechtsschutzversicherung nicht umfassend regeln zu wollen, sondern sich anlässlich der Umsetzung der Richtlinie auf die dringendsten Regelungen zu beschränken[12]. Deshalb kann dem § 158m VVG a.F. keine über die Richtlinienumsetzung hinaus gehende nationale Regelung zur Gewährleistung der freien Anwaltswahl entnommen werden.
Der Gerichshof der Europäischen Union hat in zwei Leitentscheidungen den inhaltlichen Rahmen dafür festgelegt, was die Rechtsschutzversicherungsrichtlinie unter der Freiheit der Anwaltswahl versteht. Hierbei hat er klargestellt, dass nicht jede Verbindung der Auswahl des Rechtsanwalts durch den Versicherungsnehmer mit einer Beschränkung der Kostenübernahme durch den Versicherer zu einer Unfreiheit der Anwaltswahl führt.
Die Entscheidung Eschig gegen Uniqa[13] betraf eine sogenannte „Massenschadenklausel“ in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen eines österreichischen Versicherers[14], nach welcher der Versicherer in Versicherungsfällen mit einer Schädigung einer größeren Anzahl von Versicherungsnehmern durch dasselbe Ereignis den Rechtsvertreter des Versicherungsnehmers selbst auswählen konnte. Das hat der EuGH als Verstoß gegen Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie angesehen: Nach Art. 3 bis 5 der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie stehe jedem Versicherungsnehmer die freie Wahl des Rechtsvertreters innerhalb der in den einzelnen Artikeln festgelegten Grenzen allgemein und eigenständig zu[15], dieses Recht sei in Gerichts- und Verwaltungsverfahren nicht an die Entstehung einer konkreten Interessenkollision geknüpft[16] und der Gemeinschaftsgesetzgeber habe keine Ausnahmen für Massenschäden vorgesehen[17].
In seiner späteren Entscheidung Stark gegen D.A.S.[18] hat der EuGH deutlich gemacht, dass Einschränkungen der Kostenübernahme durch den Versicherer nicht zwangsläufig mit einer Beschränkung der freien Anwaltswahl des Versicherungsnehmers gleichzusetzen sind. In den zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen eines österreichischen Versicherers war geregelt, dass sich das Recht des Versicherungsnehmers auf freie Anwaltswahl nur auf Personen bezieht, die ihren Kanzleisitz am Ort des Gerichtes oder der Verwaltungsbehörde haben. Darin liegt nach Ansicht des EuGH keine Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl: Der Deckungsumfang für die mit dem Tätigwerden eines Rechtsvertreters verbundenen Kosten sei in der Richtlinie nicht ausdrücklich geregelt[19]. Die Wahlfreiheit i.S. von Art. 4 Abs. 1 der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie gebe mithin keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten vor, unter allen Umständen die vollständige Deckung der im Rahmen der Vertretung eines Versicherungsnehmers entstandenen Kosten unabhängig vom Ort des Kanzleisitzes zu gewährleisten, sofern die freie Anwaltswahl nicht ausgehöhlt werde. Letzteres sei anzunehmen, wenn die Beschränkung der Übernahme dieser Kosten eine angemessene Wahl des Vertreters durch den Versicherungsnehmer faktisch unmöglich mache. Das zu prüfen, sei Sache der nationalen Gerichte[20]; einer Vorlage an den Unionsgerichtshof bedarf es daher nicht (Art. 267 Abs. 3 AEUV).
Diese maßgeblichen Vorgaben des EuGH sind durch die Gerichte der Mitgliedstaaten zu beachten. Dabei kann zur streitgegenständlichen Frage, wann die Grenze zur unzulässigen Verletzung der freien Anwaltswahl überschritten wird, auch die einschlägige Rechtsprechung in anderen Mitgliedstaaten, die die Rechtsschutzversicherungsrichtlinie in ihr nationales Recht überführt haben, eine Verständnishilfe sein.
Ein überzeugender Ansatz ist insoweit dem – wenn auch zeitlich vor den Entscheidungen des EuGH ergangenen – Urteil des Österreichischen Obersten Gerichtshofs (OGH) vom 22.05.2002[21] zu entnehmen. Die diesem Urteil zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sahen pro Versicherungsfall eine Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers von 20% der Kosten, mindestens 3.000 Schilling (ca. 220 €) vor, die dann entfiel, wenn der Versicherungsnehmer einen vom Versicherer vorgeschlagenen Anwalt wählte. Der OGH hat diese Klausel als Verstoß gegen das Art. 4 der Rechtsschutzversicherungsrichtlinie umsetzende nationale Recht des § 158k Abs. 1 VersVG angesehen. Maßgebliches Kriterium für eine fehlende Gesetzes- und Richtlinienkonformität sei, ob der dem Versicherungsnehmer offerierte Vorteil des Wegfalls eines Selbstbehalts die sachlich gerechtfertigte Grenze insofern überschreite, als der Versicherungsnehmer wegen der Größe des angebotenen Vorteils einem psychischen Zwang unterliege, von der freien Vertreterwahl jedenfalls nicht Gebrauch zu machen, um des ihm vom Versicherer dafür angebotenen Vermögensvorteils nicht verlustig zu gehen[22]. Diese Gefahr sei bei dem in Rede stehenden Selbstbehalt von 20% der Kosten – d.h. unter Einschluss nicht nur der Kosten für den eigenen Anwalt, sondern auch aller anderen Verfahrenskosten gegeben. Damit hat der OGH – durchaus im Sinne des Aushöhlungsgedankens in dem späteren EuGH-Urteil in der Rechtssache Stark[23] entscheidend darauf abgestellt, ob ungeachtet der verbleibenden Auswahl des Rechtsanwalts die Verbindung zwischen Anwaltswahl und Selbstbehalt auf den Versicherungsnehmer einen psychischen Zwang ausübt.
Nach richtlinienkonformer Auslegung des § 127 VVG an Hand der Vorgaben des EuGH und unter Einbeziehung der damit übereinstimmenden vom OGH entwickelten Grundsätze ist die Grenze zur Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl erst überschritten, wenn die streitgegenständliche Vertragsgestaltung einen unzulässigen psychischen Druck zur Mandatierung des vom Versicherer vorgeschlagenen Anwalts ausübt. Dies ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu entscheiden. Dabei kann es keinen Unterschied machen, ob man den Verzicht auf eine Höherstufung bei Befolgung der Anwaltsempfehlung begrifflich als Vorteil oder die andernfalls erfolgende Rückstufung als Nachteil betrachtet; von der Vermeidung eines Nachteils kann die gleiche psychische Zwangswirkung wie von einem Vorteil ausgehen. Maßgebend ist insoweit insbesondere:
Bei der Wirkweise des Anreizes zur Befolgung der Anwaltsempfehlung ist zu unterscheiden, ob sich dieser bereits auf den aktuell zu regulierenden Rechtsschutzfall auswirkt oder erst auf einen späteren. Mögliche Auswirkungen auf den – in der Regel nicht konkret vorhersehbaren – nächsten Versicherungsfall setzen den Versicherungsnehmer weniger unter Druck als finanzielle Konsequenzen für den momentan zu deckenden Rechtsschutzfall. Unter diesem Gesichtspunkt ist die psychische Einflussnahme durch die streitgegenständlichen AVB eher gering, weil sich der gebotene Anreiz nicht auf den aktuellen Rechtsschutzfall finanziell auswirkt.
Unter dem Aspekt der Dauerhaftigkeit der Auswirkungen ist zu beurteilen, wie lange die Entscheidung des Versicherungsnehmers in zeitlicher Hinsicht nachwirkt. Die psychische Beeinflussung ist umso geringer, je kürzer sich der Verzicht auf den finanziellen Anreiz auswirkt. Aus der maßgeblichen Sicht des durchschnittlichen Versicherungsnehmers erfolgt nach § 5a Abs. 3 a) ARB 2009 („Jährliche Besserstufung“) i.V.m. der Tabelle in Absatz 6 a) ARB 2009 auch in den SFKlassen M0 bis M6 eine bessere Einstufung, wenn der Vertrag während eines Versicherungsjahres schadenfrei verlaufen ist. Dies bietet dem Versicherungsnehmer die Möglichkeit, in angemessenem Zeitraum trotz seines Verzichts auf einen vom Versicherer empfohlenen Anwalt in die gleiche Position wie ein Versicherungsnehmer zu kommen, der der Empfehlung des Versicherers gefolgt ist.
Zur finanziellen Bedeutung des Anreizes als weiteren bedeutsamen Umstand gilt, dass der psychische Druck mit der Höhe des finanziellen Anreizes steigt. Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass auch moderate Beträge im Zusammenspiel mit den anderen oben genannten Faktoren zu einer psychischen Zwangswirkung führen können. Insoweit vermag jedenfalls die hier in Rede stehende finanzielle Größenordnung einer Rückstufung von maximal 150 € pro Schadenfall – unabhängig davon, ob man diese als gering bewertet oder nicht – für sich genommen weder bereits eine unzulässige psychische Zwangswirkung auszuschließen noch diese allein zu begründen.
Unter Berücksichtigung der so umschriebenen richtlinienkonformen Auslegung hat das Berufungsgericht § 127 VVG zu Unrecht als verletzt angesehen.
Hier wird die Bedeutung des finanziellen Anreizes in der Größenordnung einer Rückstufung von maximal 150 € durch die Wirkungsweise des Anreizes (keine Auswirkung auf die Regulierung des anstehenden Rechtsschutzfalles, sondern nur auf den Selbstbehalt für den nächsten Versicherungsfall) und die begrenzte Nachwirkung einer Entscheidung gegen den Anreiz (durch Zeitablauf kann sich der Selbstbehalt auf das Niveau eines Kunden, der der Empfehlung gefolgt ist, wieder absenken) so weit verringert, dass auf den durchschnittlichen Versicherungsnehmer einer Rechtsschutzversicherung kein rechtlich maßgeblicher psychischer Zwang ausgeübt wird, den von der Beklagten empfohlenen Anwalt zu mandatieren. Er mag der Anwaltsempfehlung des Versicherers der Einfachheit halber oder mangels besseren Wissens um die Qualität anderer Anwälte folgen. Eine rechtlich beachtliche übermäßige Beeinflussung, nur wegen der Konsequenzen für den Selbstbehalt den vorgeschlagenen Anwalt zu mandatieren, besteht jedoch nicht.
Die hiergegen gerichteten Einwände überzeugen nicht.
§ 129 VVG führt nicht dazu, jede Einwirkung auf den Versicherungsnehmer als unzulässige Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl zu betrachten. Richtig ist zwar, dass durch den halbzwingenden Charakter des § 127 VVG eine Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl – so sie denn vorliegt – nicht durch finanzielle Vorteile wie eine vergünstigte Prämie kompensiert werden kann. Das ergibt sich bereits daraus, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Rahmen der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB eine an sich gegebene unangemessene Benachteiligung nicht mit einem vom Kunden zu zahlenden geringeren Preis gerechtfertigt werden kann[24]. Allerdings ist damit nicht die vorgelagerte Frage beantwortet, ob § 127 VVG verletzt ist. Eine nachteilige Abweichung von halbzwingenden Vorschriften setzt zumindest voraus, dass eine Vereinbarung den Versicherungsnehmer in irgendeiner Hinsicht schlechter stellt als das Gesetz[25]. Dazu muss ihm eine Rechtsposition entzogen werden, die ihm durch die halbzwingende gesetzliche Regelung eingeräumt werden soll[26]. Hinsichtlich des Rechts auf freie Anwaltswahl ist dies nach den vorstehenden Ausführungen so lange nicht anzunehmen, wie der Versicherungsnehmer den Anwalt selbst auswählen kann und seine Entscheidung keinem unzulässigen psychischen Druck ausgesetzt ist.
Es gibt ferner keinen Widerspruch zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 26. Oktober 1989 zur Anwaltswahl durch den Mieterverein[27]. Dort wurde es als Verstoß gegen § 242 BGB und § 1 UWG angesehen, dass ein Mieterverein gegenüber dem Versicherer aus einem Gruppenversicherungsvertrag das Recht für sich in Anspruch nahm, für seine Mitglieder den Rechtsanwalt zu benennen: Dadurch werde dem Versicherten das Recht zur Anwaltswahl genommen. Soweit in dieser Entscheidung ausgeführt ist, dass das persönliche Vertrauensverhältnis des Mandanten zu seinem Anwalt die sachliche Grundlage des Mandatsverhältnisses bilde und die Anwaltswahl deshalb grundsätzlich auch nur von dem in seinen Interessen betroffenen Rechtssuchenden selbst wahrgenommen werden könne, sind diese Grundsätze hier gewahrt. Da der Versicherungsnehmer die Auswahl des Rechtsanwalts selbst trifft und dabei keinem maßgeblichen psychischen Zwang ausgesetzt ist, bleibt das persönliche Vertrauen des Versicherungsnehmers zu seinem Anwalt Grundlage des Mandatsverhältnisses.
Solange nach den zuvor dargestellten Grundsätzen das Recht des Versicherungsnehmers auf freie Anwaltswahl unangetastet bleibt, ergibt sich auch keine Verschlechterung der Situation des Versicherungsnehmers im Hinblick auf einen möglichen Interessenkonflikt zwischen dem Wunsch des Versicherungsnehmers nach Durchsetzung seiner Rechte und dem Interesse des Versicherers an einer kostengünstigen Regulierung[28].
Soweit die Klägerin in den Gebührenvereinbarungen zwischen der Beklagten und deren Partneranwälten finanzielle Nachteile für die betroffenen Anwälte erkennt, übersieht sie, dass es in der vom Bundesgerichtshof zu beurteilenden Vertragsbeziehung allein um das Verhältnis zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer geht. Dessen Interessen aus dem Versicherungsvertrag sind tangiert, wenn der Versicherer einen Partneranwalt empfiehlt, der dem Versicherungsnehmer eine schlechtere Leistung als die durch das Mandatsverhältnis geschuldete erbringt. Zwar ist es nicht generell auszuschließen, dass Vorgaben einer Gebührenvereinbarung zwischen Versicherer und Anwalt in eine unzureichende Geschäftsbesorgung des Anwalts für den Versicherungsnehmer umschlagen können. Nach dem Sachvortrag der Klägerin ist dies hier jedoch nicht anzunehmen. Insbesondere lassen die von der Klägerin aufgezeigten Abschläge in der Honorierung der Partneranwälte der Beklagten für sich genommen nicht den Schluss auf eine unzureichende Geschäftsbesorgung für den Versicherungsnehmer zu.
Da das Recht auf freie Anwaltswahl durch die in Rede stehenden Klauseln nicht berührt wird, scheiden auch Unterlassungsansprüche gemäß § 8 Abs. 1, 3 Nr. 2, §§ 3, 4 Nr. 11 UWG, §§ 127, 129 VVG und §§ 1, 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UKlaG, § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB, § 3 Abs. 3 BRAO aus.
Nach §§ 3, 4 Nr. 11 UWG handelt unlauter, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Es kann dahinstehen, ob es sich bei den Bestimmungen der §§ 127, 129 VVG um gesetzliche Vorschriften im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG handelt, da jedenfalls die von der Klägerin geltend gemachte Verletzung des § 127 VVG nicht besteht.
Gemäß § 3 Abs. 3 BRAO hat jedermann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, sich in Rechtsangelegenheiten aller Art durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl beraten und vor Gerichten, Schiedsgerichten oder Behörden vertreten zu lassen. Dieses Wahlrecht wird – ebenso wie das aus § 127 VVG – nicht durch das streitgegenständliche Schadenfreiheitssystem der Beklagten in rechtlich erheblicher Weise berührt.
Auch die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs aus §§ 1, 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UKlaG, § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind nicht gegeben.
Es besteht keine unangemessene Benachteiligung entgegen dem Gebot von Treu und Glauben. Diese setzt voraus, dass der Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen[29]. Die Anwendung dieses Maßstabs erfordert eine Ermittlung und Abwägung der wechselseitigen Interessen[30]. Da nach den oben genannten Grundsätzen eine Verletzung des Rechts auf freie Anwaltswahl ausscheidet, besteht unter diesem Gesichtspunkt auch keine unangemessene Benachteiligung des Versicherungsnehmers. Ebenso führen – entgegen der Ansicht der Klägerin – die Honorarabschläge in den Gebührenvereinbarungen der Beklagten mit ihren Partneranwälten nicht dazu, dass der Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt wird; wie ebenfalls zuvor dargelegt ist nach dem Vorbringen der Klägerin hier nicht ersichtlich, dass dies zu einer unzureichenden Geschäftsbesorgung für den Versicherungsnehmer führt.
Die Klägerin kann mangels Intransparenz nicht gemäß §§ 1, 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UKlaG, § 307 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB Unterlassung verlangen.
Anders als die Klägerin meint, ist die Formulierung, nach der Schadenfreiheit gilt, wenn der Versicherungsnehmer aus dem „Kreis der aktuell vom Versicherer empfohlenen Rechtsanwälte“ einen Anwalt beauftragt, nicht deshalb intransparent, weil offen gelassen wird, ob sich der Begriff „aktuell“ auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses oder den des Rechtsschutzfalles bezieht. Dem um Verständnis bemühten durchschnittlichen Versicherungsnehmer erschließt sich, dass hierbei der Versicherungsfall maßgeblich ist, da sich für ihn die Frage der Mandatierung eines Anwalts erst zu diesem Zeitpunkt stellt. Es entspräche auch nicht seinen Interessen, der Anwaltsempfehlung statt der im Deckungsfall aktuellen eine bei länger zurückliegendem Vertragsschluss unter Umständen schon mehrere Jahre alte Liste zu Grunde zu legen. Ebenso wenig enthält die Klausel ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht der Beklagten, da in den AVB die Leistungen des Versicherers im Einzelnen vertraglich festgelegt sind. Schließlich macht das streitgegenständliche Bedingungswerk hinreichend deutlich, welche wirtschaftlichen Vor- und Nachteile[31] für den Versicherungsnehmer im Schadenfreiheitssystem der Beklagten mit der Anwaltsempfehlung verbunden sind.
Die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1, 3 Nr. 2, §§ 3, 4 Nr. 1 UWG sind nicht erfüllt.
Nach dem festgestellten Sachverhalt, der weitere Feststellungen nicht erwarten lässt und deshalb eine Zurückverweisung an das Berufungsgericht erübrigt, führen die in Rede stehenden Regelungen jedenfalls nicht zu einer unangemessenen unsachlichen Beeinträchtigung, die in ihrer Intensität der Ausübung von Druck in menschenverachtender Weise vergleichbar ist. Der von der Beklagten in Aussicht gestellte finanzielle Vor- oder Nachteil ist nicht geeignet, die Rationalität der Entscheidung des Versicherungsnehmers für oder gegen die Beauftragung eines von der Beklagten empfohlenen Anwalts vollständig in den Hintergrund treten zu lassen[32]. Ebenso wenig ist das Schadenfreiheitssystem der Beklagten ein unverhältnismäßiges Hindernis nicht vertraglicher Art, mit dem die Ausübung der vertraglichen Rechte des Verbrauchers verhindert werden soll. Schließlich ist die von der Klägerin herangezogene Fallgruppe der Beeinflussung von Verkaufsförderern[33] nicht einschlägig, da hier der Versicherer eine Empfehlung abgibt und es nicht um seine Beeinflussung durch Personen außerhalb des Versicherungsvertragsverhältnisses geht.
Ein Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1, 3 Nr. 2, §§ 3, 4 Nr. 4 UWG besteht nicht.
Ohne Rechtsfehler hat das Landgericht die – vom Berufungsgericht offen gelassene – Frage eines Verstoßes gegen diese Bestimmung mit der Begründung verneint, dass es sich bei den beanstandeten Regelungen nicht um Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässe, Zugaben oder Geschenke handelt und zudem deren Inhalt für jeden aufmerksamen informierten Versicherungsnehmer klar und verständlich ist. Da keine weiteren Feststellungen zu erwarten sind, kann der Bundesgerichtshof die Frage selbst in Übereinstimmung mit dem Landgericht beantworten.
Weitere Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vortrag der Klägerin, dass die Beklagte bei Empfehlung eines Anwalts, der eine Gebührenvereinbarung mit ihr unterhält, auch finanzielle Vorteile erzielt und den Versicherungsnehmer hierüber im Unklaren lässt, sind nicht Gegenstand des Verfahrens geworden.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 4. Dezember 2013 – IV ZR 215/12
- vgl. BGH, Urteil vom 02.04.1998 – I ZR 4/96, GRUR 1998, 835 unter I[↩]
- BGH, Urteil vom 12.10.2011 – IV ZR 199/10, BGHZ 191, 159 Rn.19[↩]
- BGH, Urteile vom 19.12.2012 – IV ZR 21/11, VersR 2013, 354 Rn. 11; vom 11.12.2002 – IV ZR 226/01, BGHZ 153, 182, 185 f.; vom 23.06.1993 – IV ZR 135/92, BGHZ 123, 83, 85 f.[↩]
- Hillmer-Möbius, in Schwintowksi/Brömmelmeyer, VVG 2. Aufl. § 127 Rn. 3[↩]
- BR-Drucks. 707/06 S. 229[↩]
- Richtlinie 87/344/EWG des Rates vom 22.06.1987 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Rechtsschutzversicherung[↩]
- Schilasky, Einschränkungen der freien Rechtsanwaltswahl in der Rechtsschutzversicherung 1998 S. 176[↩]
- Schauer, RdW 2009, 702[↩]
- EuGH NJW 1994, 2473 Rn. 26[↩]
- vgl. BT-Drucks. 11/6341 S. 37; Schilasky aaO S. 185[↩]
- BT-Drucks. 11/6341 S.19[↩]
- BT-Drucks. 11/6341 S. 34 f.[↩]
- EuGH, NJW 2010, 355[↩]
- hierzu OGH VersR 2010, 1625; Fenyves, ÖJZ 2010, 468 und Versicherungsrundschau 2006, 22[↩]
- EuGH aaO Rn. 46[↩]
- EuGH aaO Rn. 52, 58[↩]
- EuGH aaO Rn. 60[↩]
- EuGH, NJW 2011, 3077; bestätigt durch EuGH, Urteil vom 07.11.2013 – C-442/12 Rn. 27[↩]
- EuGH aaO Rn. 32[↩]
- EuGH aaO Rn. 33; vgl. auch Armbrüster, VuR 2012, 167, 168; Wendenburg, NJW 2011, 3064, 3066[↩]
- VersR 2003, 1330; hierzu Pichler, Österreichisches Anwaltsblatt 2008, 199, 200 f.[↩]
- OGH aaO[↩]
- EuGH, aaO[↩]
- BGH, Urteile vom 16.11.1992 – II ZR 184/91, BGHZ 120, 216, 226; vom 12.05.1980 – VII ZR 166/79, BGHZ 77, 126, 131; vgl. Klimke, Die halbzwingenden Vorschriften des VVG 2004 S. 86[↩]
- Klimke aaO S. 28[↩]
- Klimke aaO[↩]
- BGH, Urteil vom 26.10.1989 – I ZR 242/87, BGHZ 109, 153[↩]
- vgl. zum Interessenkonflikt in der Rechtsschutzversicherung: BGH, Urteil vom 20.02.1961 – II ZR 139/59, NJW 1961, 1113 unter II 3 und BT-Drucks. 16/3655 S. 51[↩]
- BGH, Urteil vom 10.10.2012 – IV ZR 10/11, VersR 2013, 46 Rn. 42 m.w.N.[↩]
- BGH, Urteil vom 10.10.2012 aaO[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 10.10.2012 – IV ZR 10/11, VersR 2013, 46 Rn. 75 ff.; vom 24.03.1999 – IV ZR 90/98, BGHZ 141, 137, 143[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 24.06.2010 – I ZR 182/08, GRUR 2010, 850 Rn. 13; vom 29.10.2009 – I ZR 180/07, GRUR 2010, 455 Rn. 17 jeweils m.w.N.[↩]
- vgl. hierzu BGH, Urteile vom 24.06.2010 – I ZR 182/08, GRUR 2010, 850 Rn. 16 ff. und vom 02.07.2009 – I ZR 147/06, GRUR 2009, 969 Rn. 10 ff.[↩]