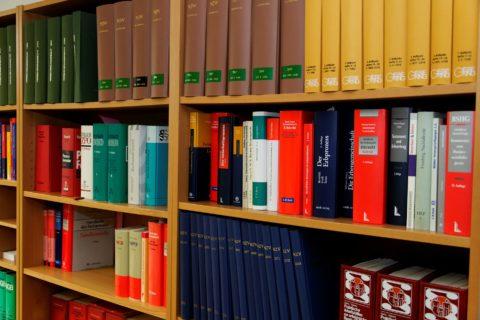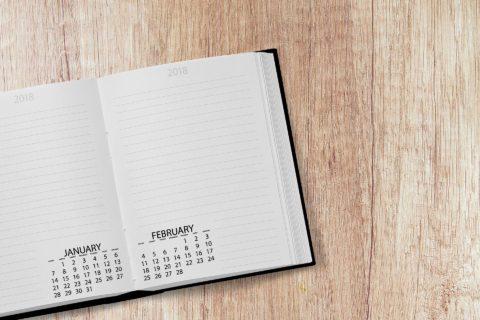Vertritt ein Rechtsanwalt einen Ehepartner in dessen Scheidungsverfahren sowie in der Folgesache Zugewinnausgleich und gleichzeitig den volljährigen Sohn bei dessen Klage auf Kindesunterhalt gegen den anderen Ehegatten, so liegt hierin nicht in jedem Fall ein Verstoß gegen das Verbot der Wahrnehmung widerstreitender Interessen, §§ 43a Abs. 4 BRAO, 3 Abs. 1 1. Alt. BORA.

Der Zugewinnausgleich und der Unterhaltsanspruch des volljährigen Kindes gegen seine Eltern betreffen allerdings dieselbe Rechtssache. „Rechtssache“ kann jede Angelegenheit sein, die zwischen mehreren Beteiligten mit jedenfalls möglicherweise entgegenstehenden rechtlichen Interessen nach Rechtsgrundsätzen behandelt und erledigt werden soll[1]. Maßgebend dafür, ob die Rechtssache dieselbe ist, ist der sachlichrechtliche Inhalt der anvertrauten Angelegenheit[2], auch wenn dasselbe materielle Interesse Gegenstand verschiedener Ansprüche oder Verfahren ist[3].
Die von dem Rechtsanwalt übernommenen Mandate decken sich sachlichrechtlich zumindest teilweise. Grundlage des Zugewinnausgleichs ist zwar die Ehe, während der Unterhaltsanspruch aus dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Eltern und Kindern folgt. Die Verwandtschaft zu miteinander verheirateten Eltern betrifft jedoch denselben Sachverhalt wie deren Ehe. Der Unterhaltsanspruch des erwachsenen Kindes richtet sich zudem grundsätzlich gegen beide Elternteile, die anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen haften (§ 1606 Abs. 3 BGB); die Vermögensverhältnisse der beiden Elternteile sind – bezogen auf den Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrags (§ 1375 Abs. 1, § 1384 BGB) – Gegenstand des Zugewinnausgleichs.
Die Interessen, welche der Rechtsanwalt bei der Abwehr des Anspruchs auf Zugewinnausgleich (fortan auch: Erstmandat) einerseits und der Durchsetzung des Anspruchs auf Kindesunterhalt (fortan auch: Zweitmandat) anderseits zu vertreten hat, widersprechen einander unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles jedoch nicht.
Die Interessen, welche der Anwalt im Rahmen des ihm erteilten Auftrags zu vertreten hat, sind objektiv zu bestimmen. Grundlage der Regelung des § 43a Abs. 4 BRAO sind das Vertrauensverhältnis von Rechtsanwalt und Mandant, die Wahrung der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts und die im Interesse der Rechtspflege gebotene Gradlinigkeit der anwaltlichen Berufsausübung[4]. Die Wahrnehmung anwaltlicher Aufgaben setzt den unabhängigen, verschwiegenen und nur den Interessen des eigenen Mandanten verpflichteten Rechtsanwalt voraus[5]. Diese Eigenschaften stehen nicht zur Disposition der Mandanten. Der Rechtsverkehr muss sich darauf verlassen können, dass der Pflichtenkanon des § 43a BRAO befolgt wird, damit die angestrebte Chancen- und Waffengleichheit der Bürger untereinander und gegenüber dem Staat gewahrt wird und die Rechtspflege funktionsfähig bleibt[6].
Im rechtlichen Ausgangspunkt stehen die Interessen eines unterhaltsberechtigten volljährigen Kindes im Widerspruch zu denjenigen seiner Eltern, die beide Unterhalt schulden und gemäß § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB anteilig nach ihren Erwerbs- und Vermögensverhältnissen haften. Ein Rechtsanwalt darf deshalb nicht zugleich die unterhaltspflichtigen Eltern bei der Abwehr des Anspruchs und das unterhaltsberechtigte Kind bei dessen Durchsetzung vertreten.
Dass der Rechtsanwalt im vorliegenden Fall nur mit der Durchsetzung des Anspruchs gegen die Ehefrau seines Mandanten beauftragt worden war, die auch dessen Gegnerin im Zugewinnausgleichsverfahren war, ändert für sich genommen nichts am Vorliegen eines Interessenwiderstreits. Ein objektiv vorhandener Interessenwiderspruch lässt sich[7] nicht durch den schlichten Hinweis darauf auflösen, dass der Mandant mit der Mandatserteilung selbst bestimmen könne, in welche Richtung und in welchem Umfang der Anwalt seine Interessen wahrnehmen möge. Zwar werden die Mandatspflichten eines Anwalts wesentlich durch den ihm erteilten Auftrag bestimmt. Der Anwalt ist an die Weisungen seines Auftraggebers gebunden (§§ 665, 675 Abs. 1)[8], wobei es dem Mandanten, der das Misserfolgs- und Kostenrisiko trägt, durchaus freisteht, Weisungen zu erteilen, welche seinen wohlverstandenen Interessen aus der Sicht eines objektiven Betrachters widersprechen[9]. Nicht selten sind Umfang und Ausgestaltung des Auftrags jedoch erst das Ergebnis der Erstberatung, welche dem Mandanten aufzeigen soll, welche Rechte er hat und wie er sie durchsetzen kann. Außerdem muss ein Anwalt den Mandanten auch im Rahmen eines eingeschränkten Mandats vor Gefahren warnen, die sich bei ordnungsgemäßer Bearbeitung des Auftrags aufdrängen, wenn er Grund zu der Annahme hat, dass sein Auftraggeber sich dieser Gefahren nicht bewusst ist[10].
Ein Anwalt, der ein volljähriges Kind bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen berät, muss darauf hinweisen, dass sich der Anspruch gegen beide Elternteile richtet. Vertritt der Anwalt bereits einen Elternteil im Rahmen einer unterhalts- oder ehegüterrechtlichen Auseinandersetzung, ist schon dieser Hinweis geeignet, dessen Interessen zu beeinträchtigen. Wenn und soweit sich die Höhe des Unterhaltsanspruchs des volljährigen Kindes nach den zusammengerechneten Einkommen beider Eltern richtet, kann das Interesse des Kindes überdies darauf gerichtet sein, ein möglichst hohes Einkommen auch desjenigen Elternteils nachzuweisen, dessen Vertretung der Anwalt bereits übernommen hatte und dessen Einkommens- und Vermögensverhältnisse dieser daher kennt. Auch dies schließt eine gemeinsame Vertretung eines Elternteils und des volljährigen Kindes im Rahmen des Kindesunterhalts grundsätzlich aus.
Ob widerstreitende Interessen bestehen und vertreten werden, kann indessen nicht ohne Blick auf die konkreten Umstände des Falles beurteilt werden. Maßgeblich ist, ob der in den anzuwendenden Rechtsvorschriften typisierte Interessenkonflikt im konkreten Fall tatsächlich auftritt[11]. Was den Interessen des Mandanten und damit zugleich der Rechtspflege dient, kann nicht ohne Rücksicht auf die konkrete Einschätzung der hiervon betroffenen Mandanten abstrakt und verbindlich von Rechtsanwaltskammern oder Gerichten festgelegt werden[12]. Die Vorschrift des § 43a Abs. 4 BRAO schränkt (ebenso wie diejenige des § 356 StGB) das Grundrecht der freien Berufsausübung der Rechtsanwälte nach Art. 12 Abs. 1 GG ein. Ihre Auslegung hat sich daran zu orientieren, dass jeder Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit durch hinreichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt sein muss und nicht weiter gehen darf, als die rechtfertigenden Gemeinwohlbelange es erfordern. Eingriffszweck und Eingriffsintensität müssen zudem in einem angemessenen Verhältnis stehen; denn die Gerichte sind, wenn sie Einschränkungen der grundsätzlich freien Berufsausübung für geboten erachten, an dieselben Maßstäbe gebunden, die nach Art. 12 Abs. 1 GG den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers einschränken[13]. Im Interesse der Rechtspflege sowie eindeutiger und gradliniger Rechtsbesorgung verlangt § 43a Abs. 4 BRAO lediglich, dass im konkreten Fall die Vertretung widerstreitender Interessen vermieden wird[14]. Das Anknüpfen an einen möglichen, tatsächlich aber nicht bestehenden (latenten) Interessenkonflikt verstößt gegen das Übermaßverbot und ist verfassungsrechtlich unzulässig[15].
Danach hat der Rechtsanwalt im vorliegend vom Bundesgerichtshof entscheidenen Verfahren keine widerstreitenden Interessen vertreten: Er ist vom volljährigen Sohn beauftragt worden, Unterhaltsansprüche (nur) gegen die Mutter geltend zu machen. Bei der Erteilung des Auftrags war der Vater zugegen. Er hat den Gebührenvorschuss an den Rechtsanwalt gezahlt. Die Frage des Unterhaltsanspruchs gegen beide Elternteile stellte sich nicht. Der Vater kam bis dahin allein für den Unterhalt seines Sohnes auf und war bereit, dies unabhängig vom Ausgang des Rechtsstreits weiterhin zu tun. Fragen der Schweigepflicht waren ebenfalls nicht berührt, nachdem der Vater dem Rechtsanwalt alle für die Berechnung des Kindesunterhalts erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt hatte. Zudem wusste der Sohn, dass der Rechtsanwalt seinen Vater im Scheidungs- und im Zugewinnausgleichsverfahren vertrat. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände fehlt es bei der gebotenen konkret objektiven Betrachtung an einem Interessengegensatz.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 23. April 2012 – AnwZ (Brfg) 35/11
- BGH, Urteil vom 25.06.2008 – 5 StR 109/07, BGHSt 52, 307 Rn. 11[↩]
- BGH, Urteil vom 16.11.1962 – 4 StR 344/62, BGHSt 18, 192, 193; BayObLG, NJW 1989, 2903[↩]
- BGH, Urteil vom 07.10.1986 – 1 StR 519/86, BGHSt 34, 191; BayObLG, NJW 1989, 2903; Fischer, StGB, 59. Aufl., § 356 Rn. 5; Hartung, AnwBl 2011, 679, 680[↩]
- BT-Drucks. 12/4993, S. 27; vgl. auch BVerfGE 108, 150[↩]
- BGH, Urteil vom 08.11.2007 – IX ZR 5/06, BGHZ 174, 186 Rn. 12 = NJW 2008, 1307[↩]
- BVerfGE 108, 150, 161 f.; vgl. auch BVerfG, NJW 2006, 2469 f.[↩]
- entgegen Henssler, NJW 2001, 1521, 1522; Deckenbrock, Strafrechtlicher Parteiverrat und berufsrechtliches Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, 2009, Rn. 279 ff.[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 15.11.2007 – IX ZR 44/04, BGHZ 174, 205 Rn. 8[↩]
- BGH, Urteil vom 20.03.1984 – VI ZR 154/82, NJW 1985, 42, 43; vom 13.03.1997 – IX ZR 81/96, NJW 1997, 2168, 2169 f.; vgl. Vill in Zugehör u.a., Handbuch der Anwaltshaftung, 3. Aufl., Rn. 841[↩]
- BGH, Urteil vom 29.04.1993 – IX ZR 101/92, NJW 1993, 2045; vom 09.07.1998 – IX ZR 324/97, WM 1998, 2246, 2247; vom 29.11.2001 – IX ZR 278/00, WM 2002, 505, 506; vgl. Vill in Zugehör u.a., Handbuch der Anwaltshaftung, 3. Aufl., Rn. 552 ff.[↩]
- RGSt 71, 231, 236 [zu § 356 StGB]; BAG, NJW 2005, 921 f.; KG, NJW 2008, 1458, 1459; aA Hartung in Hartung/Römermann, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 4. Aufl., § 3 BerO Rn. 59[↩]
- BVerfGE 108, 150, 162; vgl. auch BVerfG, NJW 2006, 2469, 2470[↩]
- BVerfGE 54, 224, 235; 97, 12, 27; 108, 150, 160; BVerfG, NJW 2006, 2469[↩]
- BVerfGE 108, 150, 164[↩]
- BAG, NJW 2005, 921, 922; Henssler in Henssler/Prütting, BRAO, 3. Aufl., § 43a Rn. 171, 174[↩]