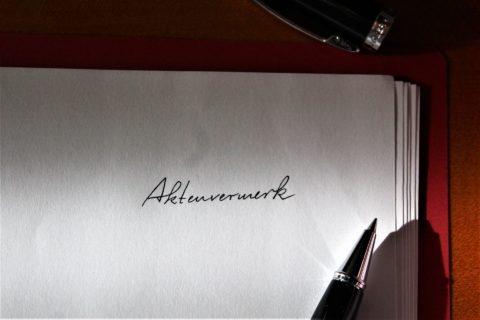Zur schlüssigen Darlegung eines Schadensersatzanspruches ist es nicht ausreichend nur vorzutragen, dass eine anwaltliche Pflicht verletzt worden sei, sondern es ist auch darzulegen, wie sich bei pflichtgemäßem Verhalten der Sachverhalt und die Vermögenslage des Geschädigten entwickelt hätten.

Sofern ein solcher Vortrag erfolgt, hat der im Schadensersatzprozess zur Entscheidung berufene Richter zu prüfen, wie nach seiner Auffassung der Vorprozess – hier bei Einlegung der Gehörsrüge – richtigerweise hätte entschieden werden müssen[1]. Darin liegt kein Verstoß gegen Art. 101 GG. Gesetzlicher Richter im Sinne von Art. 101 GG ist der zur Entscheidung des Schadensersatzprozesses berufene Richter.
Soweit der Mandant meint, der seinerzeit von ihm beauftragte Rechtsanwalt, der sich über das seinerzeitige Verfahren „aufgeregt” habe, könne nun nicht anders vortragen, ist dies unzutreffend. Der Rechtanwalt, der seinerzeit Parteivertreter war, ist nicht daran gehindert, in eigener Sache abweichenden Vortrag zu halten.
Soweit der Ex-Mandant ausführt, dass eine Verfassungsbeschwerde erst zulässig sei, nachdem gegebenenfalls die Gehörsrüge erhoben wurde, ist dies zutreffend. Die Gehörsrüge ist Teil des Rechtsweges i. S. v. § 90 Abs. 2 BVerfGG, der vor Anrufung des Verfassungsgerichts ausgeschöpft sein muss[2]. Es ist allerdings weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass die Einlegung der Verfassungsbeschwerde nach einer etwaigen Zurückweisung der Gehörsrüge durch das Landgericht erfolgreich gewesen wäre.
Oberlandesgericht Stuttgart, Beschluss vom 1. August 2014 – 12 W 27/13