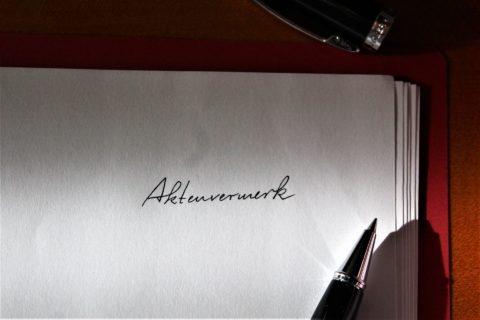Geht ein Rechtsstreit wegen eines Anwaltsfehlers verloren, ist ein Schadensersatzanspruch gegen den Rechtsanwalt nicht gegeben, wenn das Ergebnis des Vorprozesses dem materiellen Recht entspricht.

Hängt die Haftung des Anwalts vom Ausgang eines Vorprozesses ab, hat das Regressgericht nicht darauf abzustellen, wie jener voraussichtlich geendet hätte, sondern selbst zu entscheiden, welches Urteil richtigerweise hätte ergehen müssen. Dabei ist grundsätzlich von dem Sachverhalt auszugehen, der dem Gericht des Inzidentprozesses bei pflichtgemäßem Verhalten des Rechtsanwalts unterbreitet und von ihm aufgeklärt worden wäre[1].
Um die Ursächlichkeit der Pflichtverletzung eines Rechtsanwalts für den geltend gemachten Schaden festzustellen, ist zu prüfen, welchen Verlauf die Dinge bei pflichtgemäßem Verhalten genommen hätten. Ist im Haftpflichtprozess die Frage, ob dem Mandanten durch eine schuldhafte Pflichtverletzung des Rechtsanwalts ein Schaden entstanden ist, vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängig, muss das Regressgericht selbst prüfen, wie jenes Verfahren richtigerweise zu entscheiden gewesen wäre[2].
Dabei ist von dem normativen Schadensbegriff auszugehen.
Ein Geschädigter soll grundsätzlich im Wege des Schadensersatzes nicht mehr erhalten als dasjenige, was er nach der materiellen Rechtslage hätte verlangen können. Der Verlust einer tatsächlichen oder rechtlichen Position, auf die er keinen Anspruch hat, ist grundsätzlich kein erstattungsfähiger Nachteil. Durch eine fiktive Entscheidung, die gerade mit diesem Inhalt nicht hätte ergehen dürfen, wird kein schutzwürdiger Besitzstand begründet[3]. Bei wertender Betrachtung kann nämlich der Verlust eines Rechtsstreits nicht als Schaden im Rechtssinne angesehen werden, wenn sich im Anwaltshaftungsprozess herausstellt, dass die unterlegene Partei den Vorprozess materiellrechtlich zu Recht verloren hat, dieser also nach Auffassung des mit dem Anwaltshaftungsprozess befassten Gerichts im Ergebnis richtig entschieden worden ist. Der Umstand, dass die Partei bei sachgerechter Vertretung durch ihren Anwalt den Vorprozess gewonnen hätte, rechtfertigt es nicht, der Partei im Regressprozess gegen ihren Prozessbevollmächtigten einen Vermögensvorteil zu verschaffen, auf den sie nach materiellem Recht keinen Anspruch hatte. Auf diesen Fall trifft die Regel nicht zu, dass ein Schaden bereits dann bejaht werden kann, wenn die Partei einen Prozess verloren hat, den sie bei sachgemäßer Vertretung gewonnen hätte[4].
Nach diesen Maßstäben musste das Gericht in eine umfassende Prüfung eintreten, ob der Kläger in dem Vorprozess aus von den angerufenen Gerichten nicht erörterten rechtlichen Gründen unterlegen wäre.
Der normative Schadensbegriff, der eine rechtliche Endergebnisbetrachtung verlangt, gebietet, den in dem Vorprozess unterbreiteten Sachverhalt einer umfassenden rechtlichen Prüfung nach allen denkbaren Richtungen zu unterziehen. Erhebt der in einem Vorprozess verurteilte Beklagte gegen seinen Anwalt Ersatzansprüche, hat das Regressgericht zu untersuchen, ob die in dem Vorprozess aus einem bei zutreffender rechtlicher Würdigung nicht durchgreifenden rechtlichen Gesichtspunkt zugesprochene Klageforderung gleichwohl aus einem anderen Rechtsgrund begründet war. Wurde zu Unrecht ein vertraglicher Anspruch zuerkannt, muss das Regressgericht also prüfen, ob im Falle der Unwirksamkeit des Vertrages etwa insbesondere Ansprüche aus Delikt oder ungerechtfertigter Bereicherung das Klagebegehren trugen. Macht demgegenüber der in dem Vorprozess unterlegene Kläger unter Berufung auf eine fehlerhafte Prozessführung Ersatzansprüche gegen seinen Anwalt geltend, ist zu untersuchen, ob die Klage trotz der Pflichtwidrigkeit des Anwalts ohnehin unbegründet war. Diese Prüfung kann ergeben, dass ein zu Unrecht mangels Nachweis einer Einigung versagter Vertragsanspruch tatsächlich an einem Formmangel oder der Ausübung eines Gestaltungsrechts scheiterte oder einer rechtsirrig bereits dem Grunde nach abgelehnten Schadensersatzforderung ein Haftungsausschluss oder ein ganz überwiegendes Mitverschulden des Klägers (§ 254 Abs. 1 BGB) entgegenstand.
Die in dem Vorprozess obsiegende Partei hatte wegen der ihr günstigen Rechtsauffassung des entscheidenden Gerichts regelmäßig keinen Anlass, ihrerseits je nach ihrer Prozessrolle zu etwaigen weiteren Anspruchsgrundlagen oder Gegenrechten vorzutragen. Auf der Grundlage des § 287 ZPO, der für die Beurteilung gilt, wie der Vorprozess richtigerweise entschieden worden wäre[5], ist davon auszugehen, dass der Gegner des Vorprozesses nach Unterrichtung über einen nicht durchgreifenden ihm günstigen rechtlichen Gesichtspunkt nach ordnungsgemäßer Beratung durch seinen Bevollmächtigten sämtliche weiteren ihm eröffneten rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung seiner Rechtsposition genutzt hätte. Deshalb kann sich der Anwalt, der in dem Regressverfahren an die Stelle des Prozessgegners seiner Partei rückt[6], zur Vermeidung seiner Haftung auch auf rechtliche Gesichtspunkte stützen, die in dem Vorprozess überhaupt nicht angesprochen wurden. Gleiches folgt aus der Erwägung, dass ein Schaden im Rechtssinne selbst dann ausscheidet, wenn der Regresskläger bei zutreffender Beratung den Vorprozess gewonnen hätte, sich aber nachträglich herausstellt, dass er den Prozess materiellrechtlich zu Recht verloren hat[7]. Darum kann dem in Rückgriff genommenen Rechtsanwalt aus Gründen materieller Gerechtigkeit nicht verwehrt werden, sich darauf zu berufen, dass das geltend gemachte, von ihm anwaltlich vertretene Klagebegehren wegen einer etwa erst nachträglich entdeckten Täuschung unbegründet war. Bei dieser Sachlage besteht im Streitfall kein Hinderungsgrund, in eine Prüfung einzutreten, ob der Kläger in dem Vorprozess nach Maßgabe von § 823 Abs. 2 BGB, § 32 KWG aF oder eines Aufklärungsmangels ohnehin unterlegen wäre.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 25. Oktober 2012 – IX ZR 207/11
- BGH, Urteil vom 13.06.1996 – IX ZR 233/95, BGHZ 133, 110, 111 f; vom 16.06.2005 – IX ZR 27/04, BGHZ 163, 223, 227 jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 18.12.2008 – IX ZR 179/07, WM 2009, 324 Rn. 16[↩]
- BGH, Urteil vom 15.11.2007 – IX ZR 34/04, WM 2008, 41 Rn. 21[↩]
- BGH, Urteil vom 02.07.1987 – IX ZR 94/86, ZIP 1987, 1393, 1395 f[↩]
- BGH, Urteil vom 16.06.2005 – IX ZR 27/04, BGHZ 163, 223, 227[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 15.11.2007 – IX ZR 232/03, Rn. 7[↩]
- BGH, Urteil vom 02.07.1987, aaO[↩]