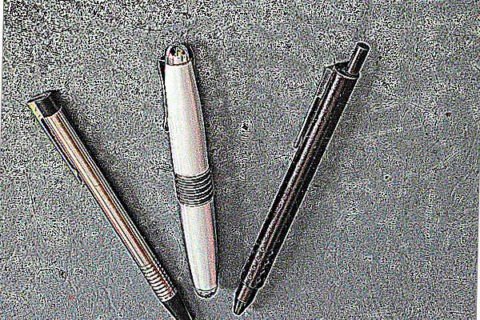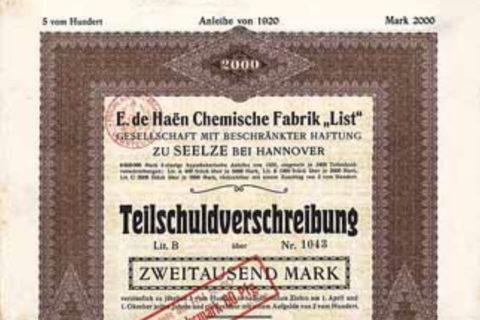Eine formularmäßig getroffene anwaltliche Zeithonorarabrede kann im Rechtsverkehr mit Verbrauchern auch deshalb unwirksam sein, weil sich eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB aus dem Gesamtzusammenhang der einzelnen vom Rechtsanwalt verwendeten Klauseln ergibt. Mit einer Stundenhonorarklausel verknüpfte Zusatzklauseln der Vergütungsvereinbarung können aufgrund eines Summierungseffekts der einzelnen Klauseln dem Rechtsanwalt zusammen mit der Intransparenz der Stundenhonorarklausel einen missbräuchlichen Gestaltungsspielraum öffnen und dazu führen, dass die Vergütungsabrede im Ganzen nicht wirksam ist. Eine teilweise Aufrechterhaltung der formularmäßig getroffenen Honorarvereinbarung kommt in einem solchen Fall nicht in Betracht.

So sah der Bundesgerichtshof in dem hier entschiedenen Fall die in der Honorarvereinbarung enthaltenen Bestimmungen zur Erhöhung des Stundensatzes, zur Auslagenpauschale, zur Einigungs- und zur Befriedungsgebühr sowie die Streit- und Anerkenntnisklausel als jedenfalls im Rechtsverkehr mit Verbrauchern unwirksam an. Diese Bestimmungen benachteiligen die Mandanten des Rechtsanwalts unangemessen (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB):
Die in der Vergütungsvereinbarungen vorgesehene Erhöhungsklausel unterwirft den vereinbarten Stundensatz (hier: 245 €) einer wertabhängigen Erhöhung im Einzelfall (10 € je angefangener 50.000 € ab 250.000 €). Diese Gestaltung des Stundensatzes ist – wie das Oberlandesgericht Nürnberg in der Vorinstanz[1] zu Recht angenommen hat – nicht klar und verständlich (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) und benachteiligt die Vertragspartner des Rechtsanwalts unangemessen (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB), insbesondere weil sie zu Stundensätzen führen kann, die mit dem vertragsrechtlichen Grundsatz der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung nicht vereinbar sind (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB).
Die Klausel verschleiert die Höhe des Stundensatzes und benachteiligt den Vertragspartner sachlich unangemessen, weil die durch die intransparente Vertragsgestaltung bewirkte Unklarheit dem Mandanten den Blick auf die preistreibende Wirkung der Erhöhungsklausel verstellt. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist die Erhöhung des Stundensatzes weder bestimmt noch abschätzbar, sofern nicht der Gegenstandswert bereits bei Mandatierung endgültig feststeht. Richtet sich der Gegenstandswert nach billigem Ermessen oder hängt er von einer Schätzung ab, eröffnet die Klausel dem Rechtsanwalt eine rechtliche Gestaltungsmöglichkeit.
Darüber hinaus verbindet die Erhöhungsklausel die Variablen beider Vergütungsarten (Zeit und Gegenstandswert) in preistreibender Weise missbräuchlich zum Nachteil des Vertragspartners. Der durchschnittliche Mandant kann dies bei Vertragsschluss nicht klar erkennen. Denn während die Zeithonorarklausel dem Mandanten zu erkennen gibt, dass es für die Berechnung nur auf den Zeitaufwand ankommt, verknüpft die Erhöhungsklausel den Stundensatz mit dem Gegenstandswert und schafft so dem Rechtsanwalt zusätzliche Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten. Deren rechtliche Voraussetzungen und Folgen kann der Verbraucher nicht übersehen. Er ist deshalb außerstande, die finanziellen Folgen abzuschätzen. Bereits aufgrund der im Vordergrund stehenden Angabe eines festen Stundensatzes von 245 € und 255 € muss der Mandant nicht mit einer Erhöhungsklausel rechnen. Zudem verschleiert die maßvoll erscheinende Satzerhöhung das Kostenrisiko, welches die Verbindung von zwei veränderlichen Preisfaktoren für den Mandanten birgt.
Die Erhöhungsklausel benachteiligt die Vertragspartner des Rechtsanwalts auch deswegen unangemessen, weil sie zu Stundensätzen führen kann, die mit dem Grundsatz der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung nicht in Einklang zu bringen sind.
Eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners des Verwenders (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB) ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Zu den wesentlichen Grundgedanken der für gegenseitige Verträge geltenden Regeln des bürgerlichen Rechts gehört der Grundsatz der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung[2]. Zwar gilt das Äquivalenzprinzip im Fall der gesetzlichen Vergütung anwaltlicher Leistungen nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nicht ohne Beschränkungen[3]. Bei der Vereinbarung eines Zeithonorars für anwaltliche Leistungen – wie hier kommt der Grundsatz jedoch uneingeschränkt zum Tragen. Denn anders als das gesetzliche Wertgebührensystem[4] folgt die Vereinbarung eines Zeithonorars nicht dem Ziel, den Lebensunterhalt des Rechtsanwalts erst durch sein Gesamtgebührenaufkommen abzusichern. Sie bezweckt eine adäquate Vergütung des konkreten Mandats, die am tatsächlichen Arbeitsaufwand zu bemessen ist.
)) Dieser Zielsetzung wird die Erhöhungsklausel nicht gerecht. Ihre Anwendung kann zu Stundensätzen führen, welche die Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung einseitig zulasten des Mandanten verfehlen und die Anwaltsvergütung ohne Rücksicht auf seine Interessen erhöhen. Ein Blick auf die Kostennote des Rechtsanwalts vom 27.12.2019 zeigt dies. In ihr errechnet der Rechtsanwalt aufgrundlage der Klausel eine Erhöhung des Ausgangssatzes (245 €) um 650 €. Er gelangt auf diesem Weg zu dessen Anhebung um das 3, 6-fache, ohne dass der Mandant diese Höhe des Stundensatzes bei Vertragsschluss erkennen konnte. Dies führt zu einer entsprechenden Vervielfachung desjenigen Netto-Honorars, welches sich auf Basis des Ausgangssatzes bei gleichem Zeitaufwand ergeben hätte.
Wie das Oberlandesgericht Nürnberg im Ergebnis zutreffend erkannt hat, benachteiligt auch die Bestimmung zur Auslagenpauschale die betroffenen Verbraucher unangemessen. Dabei kann dahinstehen, ob sich eine unangemessene Benachteiligung bereits bei einer Auslegung der Klausel nach dem bei der Wirksamkeitskontrolle (zunächst) anzuwendenden Grundsatz der kundenfeindlichsten Auslegung[5] ergäbe. Eine unangemessene Benachteiligung (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB) liegt auch dann vor, wenn in rechtlicher Hinsicht zugunsten des Rechtsanwalts unterstellt wird, dass die Klausel nur dahin verstanden werden kann, sämtliche Auslagen im Sinne des siebten Teils des Vergütungsverzeichnisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz mit Ausnahme derjenigen Kosten zu erfassen, die für die Fertigung von Kopien und „Scans“ anfallen.
Die Bestimmung zur Auslagenpauschale ist jedenfalls intransparent (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) und wegen der damit verbundenen unangemessenen Benachteiligung der Mandantin unwirksam (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB). Die Regelung, dass die Auslagenpauschale 5 % der Nettogebühren betrage, knüpft die Höhe des Aufwendungsersatzes (§ 675 Abs. 1 iVm § 670 BGB) an diejenige des Zeithonorars. Tatsächlich erhöht sie den vereinbarten Stundensatz pauschal um 5 %, ohne dass erkennbar wäre, dass mit jeder Arbeitsstunde durchschnittlich entsprechende Auslagen verbunden wären. Die Pauschalierung verstärkt zudem den – seinerseits durch missbräuchliche Vertragsgestaltung verdeckten – preistreibenden Effekt der Erhöhungsklausel. Da der durchschnittliche Vertragspartner diese Wirkung nicht erkennt, bleibt ihm bei Vertragsschluss auch verborgen, dass der nach der Auslagenklausel zu zahlende Aufwendungsersatz im Laufe der Mandatsbearbeitung ebenfalls schwer abschätzbaren Erhöhungen unterliegen und eine ganz erhebliche Höhe erreichen kann.
Entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts Nürnberg benachteiligt auch die Verbindung eines Stundenhonorars mit in der Vergütungsvereinbarungen vorgesehenen erfolgsbezogenen Zusatzgebühren die Mandanten im Verbraucherverkehr unangemessen. Durch die Aufnahme der Einigungs- und der Befriedungsgebühr in die Honorarvereinbarungen verbindet der Rechtsanwalt gebührenerhöhende Vergütungselemente des gesetzlichen Preisrechts (vgl. Nr. 1000 VV RVG und Nr. 4141 VV RVG) mit einem Stundenhonorar (Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 der Preisabreden). Dadurch blendet er einseitig zum Nachteil der betroffenen Verbraucher aus, dass das Ausgleichsbedürfnis des Rechtsanwalts, dem erfolgsbezogene Preisbestandteile im gesetzlichen Vergütungssystem Rechnung tragen, bei einer Abrechnung nach Zeit nicht besteht.
Mit seiner Entscheidung für eine Wertgebührenordnung hat der Gesetzgeber auch angestrebt, die Berechnung der anwaltlichen Vergütung zu vereinfachen[6]. Hierzu hat er das gesamte Preisrecht einem einheitlichen System unterworfen, nach dem das Anwaltshonorar anhand von wertabhängigen Gebühren berechnet wird. Damit hat der Gesetzgeber aber zugleich in Kauf genommen, die Vergütung des Rechtsanwalts vom tatsächlichen Bearbeitungsaufwand des konkreten Mandats zu entkoppeln. Dies hat zur Folge, dass das gleiche Maß an Arbeit unterschiedlich hoch vergütet wird. Bei dieser Sachlage dient der zusätzliche Anfall von Erfolgsgebühren im gesetzlichen Vergütungssystem auch dem Zweck, einen weiteren, durch die Besonderheiten des konkreten Mandats begründeten und in der Pauschgebühr nicht abgebildeten Aufwand des Rechtsanwalts dann zu vergüten, wenn dieser Mehraufwand einen Mehrwert für den Mandanten mitherbeigeführt hat.
Deshalb bezweckt die Einigungsgebühr (Nr. 1000 VV RVG) im Rahmen des gesetzlichen Gebührensystems die Vergütung mit dem Abschluss einer Einigung einhergehender Mehrbelastungen. Denn der Rechtsanwalt muss genau prüfen, ob den Interessen seines Mandanten besser durch den Abschluss einer Einigung gedient ist, als durch eine gerichtliche Entscheidung[7].
Hinsichtlich der Befriedungsgebühr (Nr. 4141 VV RVG) gilt im Grundsatz nichts anderes. Durch sie bezweckt das Gesetz allerdings nicht die Vergütung eines in der Wertgebühr nicht abgebildeten Mehraufwands. Es will lediglich einen Gebührenverlust ausgleichen, den der Verteidiger selbst durch zusätzlichen Arbeitsaufwand zu seinem finanziellen Nachteil mitverursacht hat. Denn im Rahmen der gesetzlichen Gebührenordnung dient die als Erfolgstatbestand ausgestaltete Gebühr des Nr. 4141 VV RVG dazu, zeitaufwändige Tätigkeiten des Verteidigers zu vergüten, die zur Vermeidung der Hauptverhandlung und damit zum Verlust der Hauptverhandlungsgebühr führen[8].
Ein vergleichbarer Ausgleichsbedarf besteht im Rahmen der getroffenen Honorarvereinbarungen jedoch nicht. Denn der Rechtsanwalt erhält sowohl den für eine Einigung als auch für die Einstellung der in Absatz 2 Satz 3 der Preisabreden bezeichneten Verfahren erforderlichen Arbeitsaufwand bereits über das Zeithonorar (Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 der Preisabreden) vergütet. Beide Gebühren dienen nicht dem Ausgleich einer Sonderbelastung des Rechtsanwalts. Sie bezwecken auch nicht die Kompensation eines Vergütungsbestandteils, zu dessen Wegfall der Rechtsanwalt selbst im Rechtsschutzinteresse des Mandanten beigetragen hat. Im Rahmen der vorliegenden Honorarvereinbarungen zielen die Gebührentatbestände allein auf die Erhöhung der Anwaltsvergütung ab. Der Rechtsanwalt soll beide Gebühren zusätzlich zum Zeithonorar erhalten. Damit verfolgt der Rechtsanwalt sein Ziel, die Anwaltsvergütung zu optimieren, treuwidrig auf Kosten der betroffenen Mandanten. Denn ihr berechtigtes Interesse, bei der Vereinbarung eines Zeithonorars nur den tatsächlich für die Mandatsbearbeitung anfallenden Aufwand zu vergüten, nimmt der Rechtsanwalt von vorneherein nicht in den Blick.
Schließlich benachteiligen die Bestimmungen der Streit- und Anerkenntnisklauseln die betroffenen Verbraucher unangemessen. Wie das Oberlandesgericht Nürnberg zutreffend erkannt hat, zielen beide Bestimmungen schon für sich genommen, erst recht aber in ihrem Zusammenwirken darauf ab, dem Mandanten die Erhebung von Einwänden gegen den abgerechneten Zeitaufwand zu erschweren. Dadurch verlagern die Regelungen die mit der Vereinbarung eines Zeithonorars verbundenen Risiken bei der Darlegung, Nachprüfbarkeit und dem Nachweis des tatsächlichen Bearbeitungsaufwands einseitig zulasten des Mandanten. Denn gerade die Pflicht des Rechtsanwalts, über den Zeitaufwand nachvollziehbar und im Einzelnen abzurechnen, die während des abgerechneten Zeitintervalls getroffenen Maßnahmen konkret und in nachprüfbarer Weise darzulegen und diesen Zeitaufwand im Streitfall zu beweisen[9], kompensiert den unzureichenden Einblick des Mandanten in den tatsächlich erforderlichen Aufwand.
Die Unwirksamkeit dieser Klauseln führt zur Unwirksamkeit der Preisabrede im Ganzen. Dies folgt aus der Gesamtwürdigung der Vergütungsvereinbarung, deren einzelne Klauseln in einem untrennbaren inhaltlichen Zusammenhang stehen.
Bei der Inhaltskontrolle einer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Klausel ist diese nicht isoliert, sondern unter Berücksichtigung des gesamten Vertragsinhalts zu würdigen. Denn die Interessenwidrigkeit kann auch darin bestehen, dass sich Benachteiligungen des Vertragspartners aus dem Zusammentreffen mehrerer sachlich zusammenwirkender Klauseln ergeben, deren Effekte sich verstärken, sodass die aus der Gesamtregelung für den Vertragspartner des Klauselverwenders resultierende Benachteiligung unangemessen ist[10].
Nach diesen Maßstäben wirken die einzelnen Regelungen des Klauselwerks zur Vergütung zusammen auf eine unangemessene Benachteiligung des Verbrauchers zugunsten des anwaltlichen Vergütungsinteresses hin. Diese rechtsmissbräuchliche Gesamtkonzeption unterscheidet die vom Rechtsanwalt gestellten Vergütungsvereinbarungen von der Preisabrede, über welche der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 13.02.2020 befunden hat[11].
Die Bestimmungen des Klauselwerks sind im hier entschiedenen Fall entgegen Treu und Glauben in einer Weise aufeinander abgestimmt, welche einseitig dem Vergütungsinteresse des Rechtsanwalts Rechnung trägt. Der rechtliche Gehalt der formularmäßigen Preisabrede wird maßgeblich durch das Zusammenspiel der Klauseln geprägt, die in ihrem Gesamtzusammenhang auf die Erhöhung des Anwaltshonorars ausgerichtet sind. Dabei eröffnen die inhaltlich zusammenhängenden Klauseln dem Rechtsanwalt zusammen mit der Intransparenz der Stundenhonorarklausel einen missbräuchlichen Gestaltungsspielraum. Diesem Ziel dient die Bestimmung über die Anhebung des Stundensatzes durch preistreibende Verbindung zweier Vergütungsfaktoren (Erhöhungsklausel) ebenso wie die an die Höhe des variablen Stundensatzes geknüpfte Pauschalierung von Auslagen (Auslagenklausel). In gleicher Weise erstrebt der Rechtsanwalt durch die Verknüpfung des Zeithonorars mit Vergütungsbestandteilen des gesetzlichen Gebührenrechts, sein Honorar weiter zu optimieren (Einigungsgebühr und Befriedungsgebühr). Gleichzeitig zielen Streit- und Anerkenntnisklausel darauf ab, die dem Mandantenschutz dienende Nachweispflicht des Rechtsanwalts bei Streit über die abgerechnete Stundenzahl leerlaufen zu lassen. Die isolierte Aufrechterhaltung allein der Stundenhonorarabrede würde den Inhalt des Klauselwerks grundlegend ändern.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 12. September 2024 – IX ZR 65/23
- OLG Nürnberg, Urteil vom 07.03.2023 – 11 U 3141/22[↩]
- etwa BGH, Urteil vom 12.06.2001 – XI ZR 274/00, BGHZ 148, 74, 82 unter – III 2 b[↩]
- BGH, Urteil vom 13.02.2020 – IX ZR 140/19, BGHZ 224, 350 Rn. 18[↩]
- dazu BGH, Urteil vom 13.02.2020, aaO Rn. 14[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 05.05.2022 – VII ZR 176/20, ZIP 2022, 1394 Rn. 39 mwN[↩]
- etwa Gerold/Schmidt/Müller-Raabe, RVG, 26. Aufl., Einleitung Rn. 4[↩]
- vgl. Gerold/Schmidt/Müller-Raabe, RVG, 26. Aufl., Nr. 1000 VV RVG Rn. 2[↩]
- etwa Kapischke in Ahlmann/Kapischke/Pankartz/Rech/Schneider/Schütz, RVG, 11. Aufl., Nr. 4141 VV RVG Rn. 1[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 04.02.2010 – IX ZR 18/09, BGHZ 184, 209 Rn. 77 ff[↩]
- BGH, Urteil vom 17.10.2017 – XI ZR 157/16, ZIP 2017, 2343 Rn. 38 mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 13.02.2020 – IX ZR 140/19, BGHZ 224, 350 Rn. 1 iVm Rn. 27 und 36[↩]