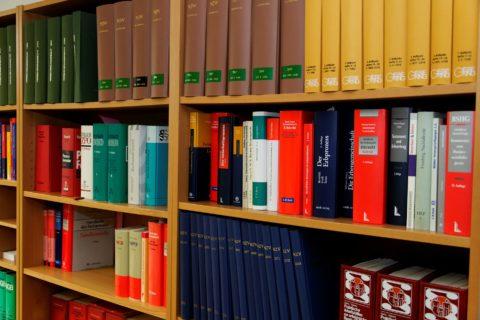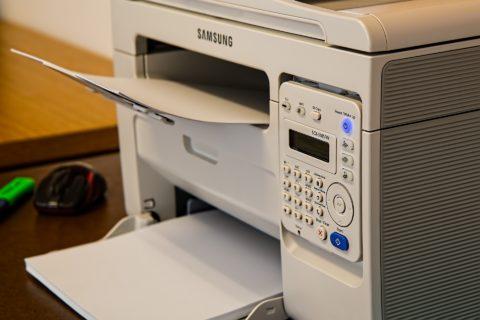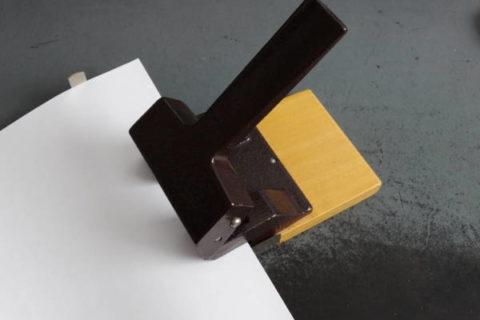Voraussetzung einer wirksamen Zustellung gegen Empfangsbekenntnis an eine der in § 173 Abs. 2 ZPO aufgeführten Personen ist neben der Übermittlung des Schriftstücks in Zustellungsabsicht die Empfangsbereitschaft des Empfängers.

Die Entgegennahme des zuzustellenden Schriftstücks muss mit dem Willen erfolgen, es als zugestellt gegen sich gelten zu lassen.
Zustellungsdatum ist deshalb der Tag, an dem der Zustellungsadressat vom Zugang des übermittelten Schriftstücks persönlich Kenntnis erlangt, es empfangsbereit entgegennimmt und dies entsprechend beurkundet[1].
Die Zustellung eines elektronischen Dokuments an einen Rechtsanwalt nach § 173 Abs. 2 Nr. 1 ZPO wird gemäß § 173 Abs. 3 Satz 1 ZPO durch ein elektronisches Empfangsbekenntnis nachgewiesen, das an das Gericht zu übermitteln ist. Für die Übermittlung ist gemäß § 173 Abs. 3 Satz 2 ZPO der vom Gericht mit der Zustellung zur Verfügung gestellte strukturierte Datensatz zu verwenden[2].
Nach diesen Grundsätzen wurde die Zustellung des Beschlusses durch das das Zustelldatum bezeichnende elektronische Empfangsbekenntnis nachgewiesen, sofern das Dokument selbst keine Anhaltspunkte dafür enthält, dass es nicht ordnungsgemäß erstellt und übermittelt worden wäre.
Das in diesem Empfangsbekenntnis angegebene Zustellungsdatum ist nicht durch die Angabe eines früheren Datums im Schriftsatz der Rechtsbeschwerdeeinlegung widerlegt[3].
Das von einem Rechtsanwalt elektronisch abgegebene Empfangsbekenntnis erbringt – wie das herkömmliche papiergebundene (analoge) Empfangsbekenntnis – gegenüber dem Gericht den vollen Beweis nicht nur für die Entgegennahme des Dokuments als zugestellt, sondern auch für den angegebenen Zeitpunkt der Entgegennahme[4]. Der Beweis, dass das zuzustellende Schriftstück den Adressaten tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt erreicht hat, ist zwar nicht ausgeschlossen; nicht ausreichend ist aber eine bloße Erschütterung der Richtigkeit der Angaben im Empfangsbekenntnis. Vielmehr muss die Beweiswirkung vollständig entkräftet, also jede Möglichkeit der Richtigkeit der Empfangsbestätigung ausgeschlossen werden. Diese für Empfangsbekenntnisse in Papierform bestehenden Grundsätze gelten ebenso für auf einem sicheren Übermittlungsweg übermittelte elektronische Empfangsbekenntnisse[5].
Hiernach ist der durch das elektronische Empfangsbekenntnis geführte Beweis einer Zustellung des landesarbeitsgerichtlichen Beschlusses am 4.07.2023 nicht dadurch widerlegt, dass der Schriftsatz der Rechtsbeschwerdeeinlegung die Formulierung „per beA zugestellt am 29.06.2023“ enthält. Dies mag Zweifel hinsichtlich der Angaben im Empfangsbekenntnis auslösen, hat aber keine durchgreifende Entkräftung der Beweiswirkung des elektronischen Empfangsbekenntnisses in dem aufgezeigten Regelungsgefüge zur Folge. Es ist zu berücksichtigen, dass ein Eingang der elektronisch versandten angefochtenen Entscheidung noch am 29.06.2023 im beA des Verfahrensbevollmächtigten der Arbeitgeberin zwar wahrscheinlich sein dürfte, sodass die Angabe dieses Datums im Rechtsbeschwerdeeinlegungsschriftsatz im technischen Sinn sogar zutreffen mag. Allerdings bewirkte dies keine Zustellung im Sinn einer empfangsbereiten Entgegennahme. Jedenfalls rechtfertigt die Angabe nicht die Annahme, die Beweiskraft des Empfangsbekenntnisses sei beseitigt.
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 24. April 2024 – 7 ABR 26/23
- vgl. zum Empfangsbekenntnis in Papierform BAG 20.11.2019 – 5 AZR 21/19, Rn.19 mwN[↩]
- BGH 17.01.2024 – VII ZB 22/23, Rn. 10; vgl. zu den technischen Grundlagen Müller RDi 2024, 139, 141; ders. RDi 2022, 488, 490 f.[↩]
- vgl. demgegenüber, zu einer Konstellation, in der das elektronische Empfangsbekenntnis ein früheres Zustellungsdatum ausweist als in einem zuvor zur Akte gereichten Schriftsatz angegeben – BGH 18.04.2023 – VI ZB 36/22, Rn. 10 ff.[↩]
- vgl. BGH 17.01.2024 – VII ZB 22/23, Rn. 10 mwN; BVerwG 19.09.2022 – 9 B 2.22, Rn. 12; Anders/Gehle/Vogt-Beheim ZPO 82. Aufl. § 173 Rn. 7[↩]
- vgl. BGH 18.04.2023 – VI ZB 36/22, Rn. 11; ausf. auch BSG 14.07.2022 – B 3 KR 2/21 R, Rn. 16 mwN, BSGE 134, 265[↩]