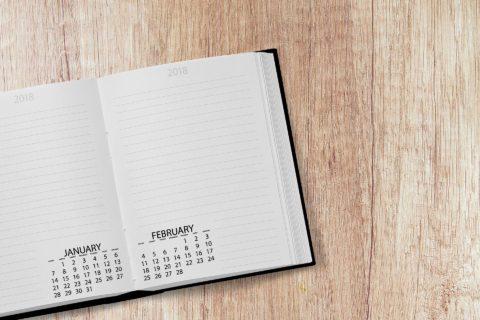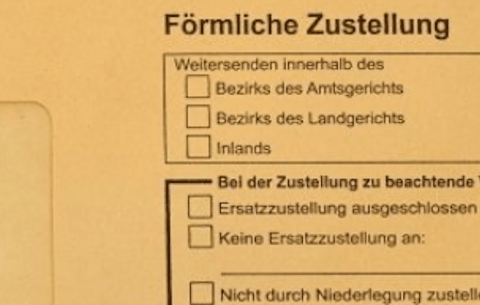Mit den Voraussetzungen der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Terminsvertreters hatte sich der Bundesgerichtshof erneut[1] zu befassen.

Dem zugrunde lag ein Fall aus Würzburg. Der Kläger erhob beim Amtsgericht Würzburg Klage auf Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall. Im Verhandlungstermin trat für die in S. ansässigen Beklagtenvertreter eine in Würzburg ansässige Rechtsanwältin mit einer im Namen der Beklagtenvertreter erteilten Terminsvollmacht auf. Nach Rücknahme der Klage erlegte das Amtsgericht dem Kläger die Kosten des Rechtsstreits auf. Der Beklagte hat die Festsetzung von Kosten in Höhe von 639, 63 € beantragt. Dieser Betrag setzt sich unter anderem aus einer „1, 2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV RVG“ in Höhe von 152, 40 € und „Auslagen Vorb 7 – I 1 VV RVG iVm §§ 670, 675 BGB gem. beigefügter Rechnung“ in Höhe von 200 €, jeweils zzgl. Mehrwertsteuer, zusammen. Dem Kostenfestsetzungsantrag ist eine an die Beklagtenvertreter gerichtete Kostenrechnung der Terminsvertreterin beigefügt, die eine „Pauschale für Terminsvertretung“ in Höhe von 200 € zzgl. Mehrwertsteuer ausweist.
Das Amtsgericht Würzburg hat die Kosten ohne die geltend gemachten Auslagen für die Terminsvertreterin festgesetzt[2]. Gegen die teilweise Ablehnung hat sich der Beklagte mit der Beschwerde gewandt. Zur Begründung hat er ausgeführt, durch die Beauftragung einer Terminsvertreterin seien Reisekosten seiner Prozessbevollmächtigten zum Termin in Würzburg in Höhe von 380, 70 € vermieden worden. Das Landgericht Würzburg hat die Beschwerde zurückgewiesen[3]. Die vom Landgericht Würzburg zugelassene Rechtsbeschwerde des Beklagten wies der Bundesgerichtshof nun als unbegründet zurück; das Landgericht Würzburg sei zu Recht davon ausgegangen, dass die Kosten der Terminsvertreterin im Streitfall nicht erstattungsfähig sind.
Das Landgericht Würzburg hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, die Beklagtenvertreter hätten die Terminsvertreterin im eigenen Namen beauftragt. Das ergebe sich aus der im Namen der Beklagtenvertreter der Terminsvertreterin erteilten Vollmacht, der an die Beklagtenvertreter gerichteten Rechnung der Terminsvertreterin und den Angaben im Kostenfestsetzungsantrag. Das Landgericht Würzburg folge der Ansicht des Oberlandesgerichts Hamm[4], dass in einem solchen Fall die Kosten der Terminsvertreterin nicht erstattungsfähig seien. Eine Erstattungspflicht komme nach Maßgabe des § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO allein unter dem Gesichtspunkt gesetzlicher Auslagen nach Teil 7 VV RVG in Betracht. Soweit besondere Geschäftskosten in Nr. 7000 ff. VV RVG nicht geregelt seien, könne der Rechtsanwalt sie gemäß Vorbemerkung 7 Abs. 1 Satz 2 VV RVG ersetzt verlangen, sofern es sich um Aufwendungen im Sinne von § 675 iVm § 670 BGB handele. Die Vergütung des vom Hauptbevollmächtigten im eigenen Namen beauftragten Terminsvertreters sei jedoch keine solche Aufwendung. Zu den höchstpersönlichen anwaltlichen Pflichten gehöre die Wahrnehmung von Verhandlungsterminen für den Mandanten. Für die Erteilung einer Untervollmacht bedürfe es einer Beteiligung des Mandanten, entweder indem dieser den Unterbevollmächtigten selbst oder der Prozessbevollmächtigte ihn namens und mit Vollmacht des Mandanten beauftrage. Nur dann komme ein Vertrag zwischen dem Mandanten und dem Unterbevollmächtigten zustande. Bei einer Auftragserteilung durch den Hauptbevollmächtigten im eigenen Namen bestehe eine vertragliche Beziehung nur zwischen den Rechtsanwälten. In diesem Fall sei die Vergütung des vom Hauptbevollmächtigten beauftragten Terminsvertreters auch vom Hauptbevollmächtigten zu tragen und könne nicht dem Mandanten in Rechnung gestellt werden. Dies gelte selbst dann, wenn der Prozessgegner im Ergebnis besser stehe, als er stünde, hätte der Hauptbevollmächtigte den Termin selbst wahrgenommen oder die Partei den Terminsvertreter beauftragt, der dann eine Vergütung nach Nr. 3401, 3402 VV RVG hätte beanspruchen können.
Gegen diese Erwägungen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht Würzburg angenommen, dass die in Rechnung gestellten Kosten der Terminsvertreterin nicht gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO erstattungsfähig sind.
Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Gemäß § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO sind die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war.
Das Landgericht Würzburg ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass der Beklagte der Terminsvertreterin keine Vergütung zu entrichten hat, die vom Kläger zu erstatten wäre.
Hat die Partei selbst oder ihr Prozessbevollmächtigter in ihrem Namen einen Rechtsanwalt mit der Terminsvertretung beauftragt, fallen für diesen eine hälftige Verfahrensgebühr (Nr. 3401 VV RVG) und eine Terminsgebühr (Nr. 3402 VV RVG) sowie ggf. Auslagen des Terminsvertreters an. Solche Kosten stellen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs notwendige Kosten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO dar, wenn durch die Tätigkeit des Terminsvertreters erstattungsfähige Reisekosten des Hauptbevollmächtigten in vergleichbarer Höhe erspart werden, die ansonsten bei der Wahrnehmung des Termins durch den Hauptbevollmächtigten entstanden wären[5].
Hat hingegen der Prozessbevollmächtigte der Partei einen Rechtsanwalt mit der Terminsvertretung im eigenen Namen beauftragt, so ist der Terminsvertreter regelmäßig Erfüllungsgehilfe des Prozessbevollmächtigten. Der Prozessbevollmächtigte erhält nach § 5 RVG in diesem Fall selbst die Terminsgebühr (Nr. 3104, 3202 VV RVG). Zwischen der Partei und dem Terminsvertreter wird dann kein Vertragsverhältnis begründet, das eine Vergütungspflicht der Partei auslösen könnte. Der Anspruch des Terminsvertreters auf das vereinbarte Honorar richtet sich ausschließlich gegen den Prozessbevollmächtigten als seinen Auftraggeber[6].
So liegt der Fall hier. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Landgerichts Würzburg haben die Beklagtenvertreter die Terminsvertreterin im eigenen Namen und nicht im Namen des Beklagten beauftragt. Ein Vertragsverhältnis ist damit nur zwischen den Beklagtenvertretern und der Terminsvertreterin entstanden. Der Beklagte hat der Terminsvertreterin daher keine Vergütung zu entrichten, die ihm zu erstatten sein könnte.
Das Landgericht Würzburg hat zu Recht angenommen, dass das von den Beklagtenvertretern der Terminsvertreterin geschuldete Honorar keine erstattungsfähigen gesetzlichen Auslagen der Beklagtenvertreter im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO sind.
Nach Vorbemerkung 7 Abs. 1 Satz 2 VV RVG kann der Rechtsanwalt, soweit nichts anderes bestimmt ist, Ersatz der entstandenen Aufwendungen (§ 675 iVm § 670 BGB) verlangen. Ob ein Prozessbevollmächtigter, der einen Rechtsanwalt im eigenen Namen mit der Wahrnehmung eines Verhandlungstermins beauftragt hat, das diesem versprochene Honorar als Aufwendung im Sinne dieser Bestimmungen erstattet verlangen kann, ist in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung und Literatur umstritten[7]. Nach Erlass des angefochtenen Beschlusses hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass solche Kosten keine erstattungsfähigen Aufwendungen im Sinne der Vorbemerkung 7 Abs. 1 Satz 2 VV RVG iVm § 675 Abs. 1, § 670 BGB sind. Denn der Hauptbevollmächtigte, der die ihn treffende Pflicht zur Wahrnehmung des Verhandlungstermins einem Terminsvertreter überträgt, handelt nicht fremdnützig – wie es der Aufwendungsersatz nach § 670 BGB erfordern würde , sondern zu eigenen geschäftlichen Zwecken[8]. Er lässt die von ihm geschuldete Leistung, die einen (Haupt)Gegenstand des Auftrags seines Mandanten bildete, von einer dritten Person erbringen. Hinzu kommt, dass das dem Terminsvertreter geschuldete Honorar für die Wahrnehmung des Verhandlungstermins eine Tätigkeit betrifft, für die der Hauptbevollmächtigte nach § 5 RVG selbst eine Terminsgebühr verdient und die deshalb bereits durch seine gesetzliche Vergütung abgegolten ist[9].
Die Rechtsbeschwerde macht erfolglos geltend, die Beklagtenvertreter hätten mit der Beauftragung der Terminsvertreterin den Zweck verfolgt, höhere Reisekosten, die bei Wahrnehmung des Termins vor dem Amtsgericht Würzburg durch die Beklagtenvertreter entstanden wären, zu vermeiden. Dies ändert nichts daran, dass nach dem Inhalt der Vergütungsvereinbarung zwischen den Prozessbevollmächtigten des Beklagten und der Terminsvertreterin das von ihr in Rechnung gestellte Honorar die Gegenleistung für den im eigenen Interesse der Beklagtenvertreter wahrgenommenen Verhandlungstermin war. Diese anwaltliche Tätigkeit seiner Prozessbevollmächtigten kann dem Beklagten nicht doppelt in Rechnung gestellt werden, einmal mit der durch die Terminsvertretung verdienten Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG iVm § 5 RVG) und zusätzlich mit dem der Terminsvertreterin versprochenen Honorar als Aufwendung im Sinne von Vorbemerkung 7 Abs. 1 Satz 2 VV RVG iVm §§ 675, 670 BGB[10].
Der Wertung, dass Kosten der Terminsvertreterin keine Auslagen im Sinne von Vorbemerkung 7 Abs. 1 Satz 2 VV RVG sind, steht auch nicht entgegen, dass nach einer von der Rechtsbeschwerde angeführten, in Literatur und Rechtsprechung vertretenen Ansicht dem im Rahmen der Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwalt die Kosten eines Terminsvertreters als Auslagen nach § 46 RVG zu erstatten seien[11]. Die Rechtsbeschwerde lässt außer Betracht, dass sich der Vergütungsanspruch im Rahmen der Prozesskostenhilfe gegen die Staatskasse richtet und die angeführte Ansicht die Erstattungsfähigkeit unter Heranziehung prozesskostenhilferechtlicher Erwägungen bejaht[12].
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 26. März 2024 – VI ZB 58/22
- im Anschluss an BGH, Beschlüsse vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126; vom 22.05.2023 – VIa ZB 22/22, NJW-RR 2023, 1286[↩]
- AG Würzburg, Beschluss vom 02.03.2022 – 16 C 388/21[↩]
- LG Würzburg, Beschluss vom 19.07.2022 – 3 T 557/22[↩]
- OLG Hamm, Beschluss vom 15.10.2019 – 25 W 242/19[↩]
- vgl. BGH, Beschlüsse vom 22.05.2023 – VIa ZB 22/22, NJW-RR 2023, 1286 Rn. 12; vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126 Rn. 12 f.; jeweils mwN[↩]
- vgl. BGH, Beschlüsse vom 22.05.2023 – VIa ZB 22/22, NJW-RR 2023, 1286 Rn. 13; vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126 Rn. 13; jeweils mwN[↩]
- vgl. zum Meinungsstand BGH, Beschluss vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126 Rn. 27 f.; ergänzend BGH, Beschluss vom 22.05.2023 – VIa ZB 22/22, NJW-RR 2023, 1286 Rn. 17[↩]
- vgl. BGH, Beschlüsse vom 22.05.2023 – VIa ZB 22/22, NJW-RR 2023, 1286 Rn. 18; vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126 Rn. 32[↩]
- vgl. BGH, Beschlüsse vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126 Rn. 32 ff.; vom 22.05.2023 – VIa ZB 22/22, NJW-RR 2023, 1286 Rn. 18[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 22.05.2023 – VIa ZB 22/22, NJW-RR 2023, 1286 Rn.20 mwN[↩]
- vgl. Schneider, NJW-Spezial 2020, 381; OLG Hamm, MDR 2014, 308 5; OLG Brandenburg, AnwBl.2007, 728 3; KG Berlin, Beschluss vom 01.11.2004 – 19 WF 222/04 3 [noch zu § 126 BRAGO]; weitere Nachweise, auch zur Gegenansicht: BGH, Beschluss vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126 Rn. 36[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 09.05.2023 – VIII ZB 53/21, NJW 2023, 2126 Rn. 36[↩]